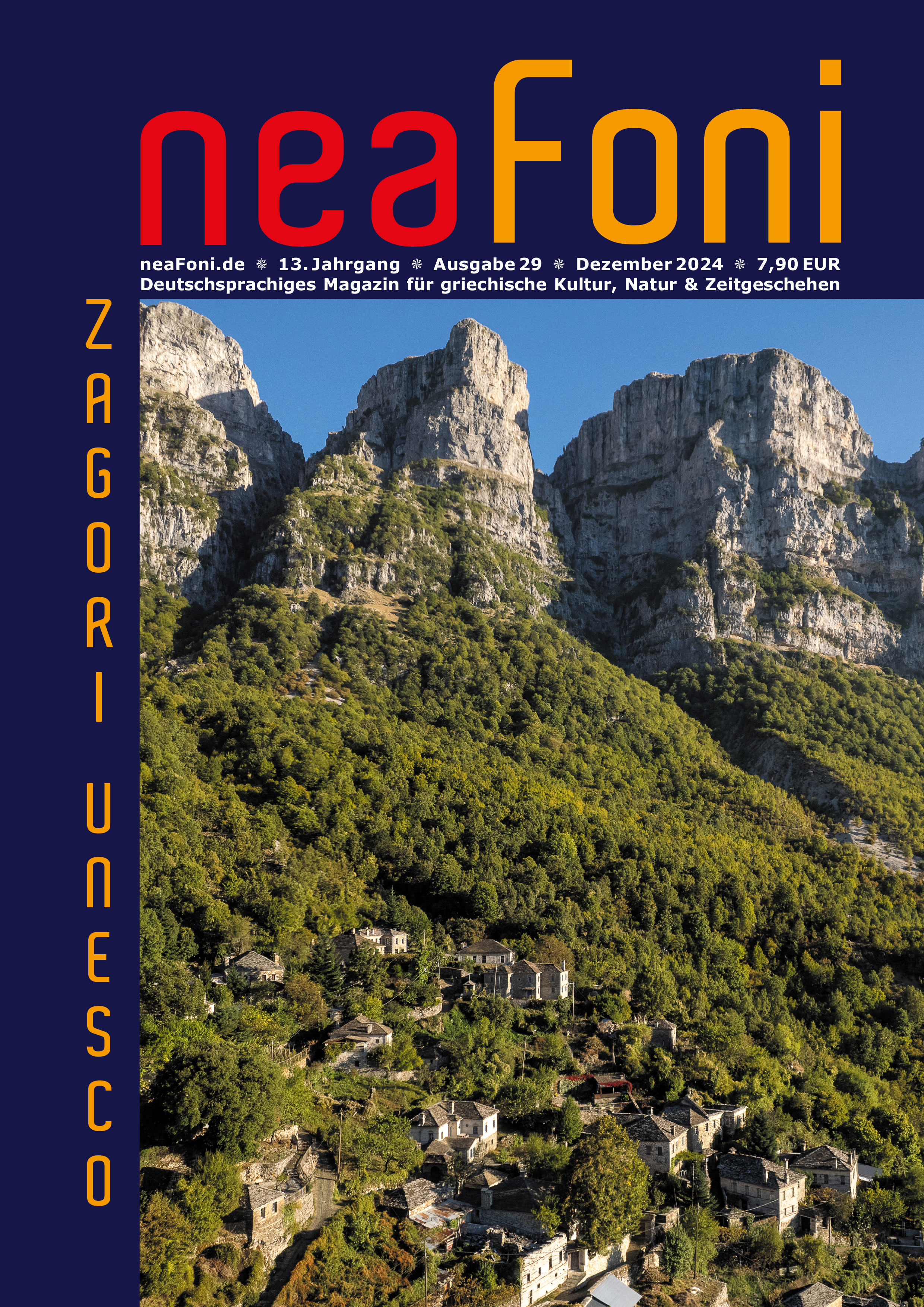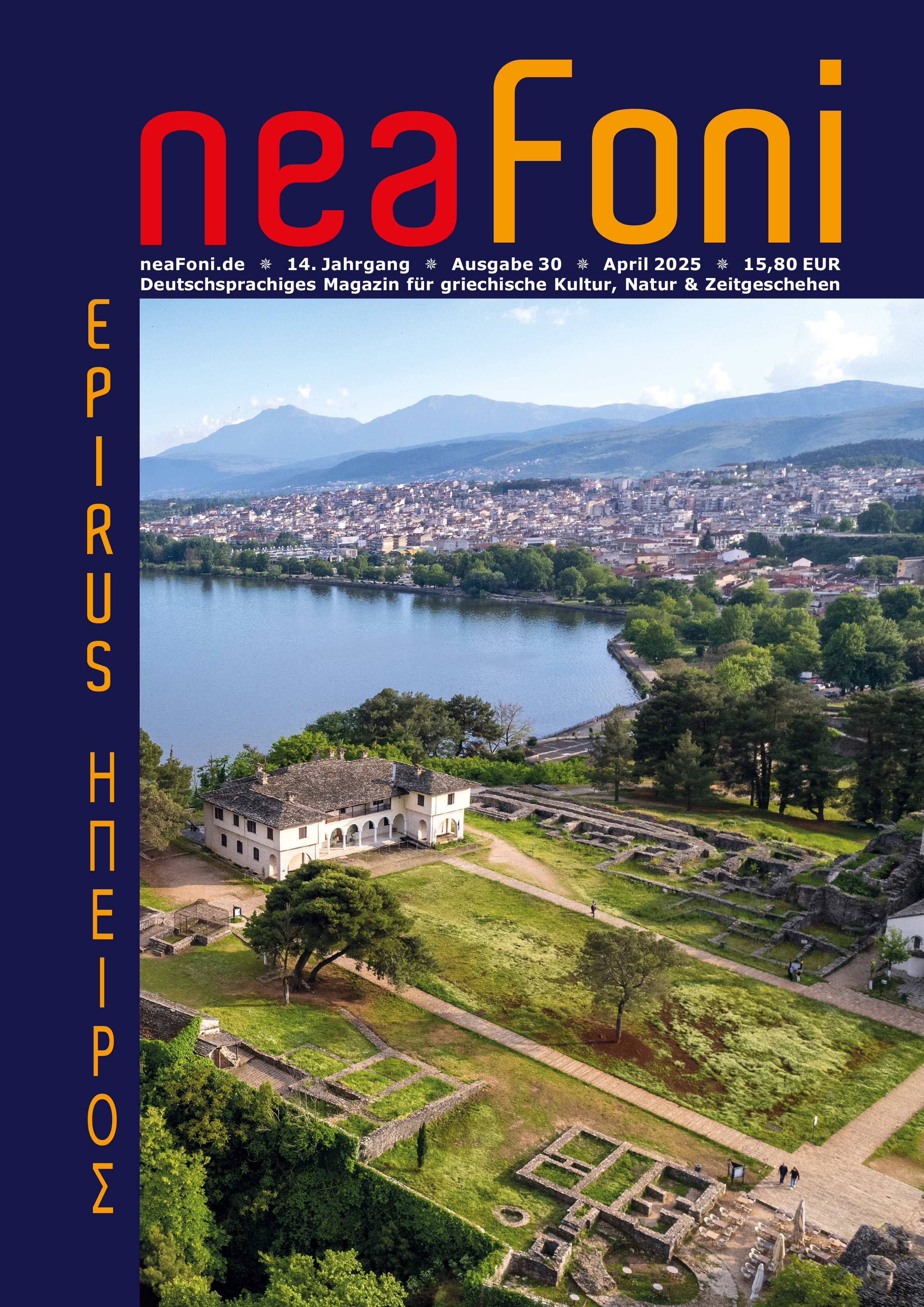Ich sitze auf der Terrasse von Perikles Niotis’ Fischtaverne TO NEON in Tolo, einem ehemals kleinen Fischerdorf auf dem Peloponnes. Mein Blick schweift über die nächtliche Bucht. Im Vollmondschein tuckert ein Kaiki, eines der traditionellen hölzernen Fischerboote, mit Hilfe seines hörbar alten Dieselmotors zwischen den beiden unbewohnten Inseln Romvi und Koronissi entlang. In diesem Bereich ist das Fischen heute verboten. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren mit Mitso, dem legendären Oktopusfischer von Tolo, dort draußen zum Tintenfischfang war. Mitso fing eine Krake nach der anderen, während meine Leine leer blieb. Er schaute mich neckisch grinsend über den Rand seiner Bierflasche hin an und sagte: „Hör ruhig auf, du fängst eh nichts.“ Dann lachte er liebevoll verrückt und setzte seine Flasche Amstel-Bier an die Lippen. Und bevor er die braune Flasche des ausländischen Bieres in einem Zug leerte, ergänzte er: „The octopus likes Amstel! Hahaha.“ Als wir nach drei Stunden sein Kaiki verließen, hatte er drei oder vier leere Amstelflaschen und sechs oder sieben Kilogramm Tintenfisch im Eimer. Ich hingegen trug nur meine leere Flasche griechischen Mythos-Bieres zurück zum Kasten von Perikles’ Taverne.
Seit 1950 existiert die „Εξοχεική Ταβέρνα το Νέον“, die „Landgaststätte zum Neuen“, die Perikles’ Eltern direkt am Strand errichtet haben. Vater Aristides war selbst Fischer und der fangfrische Fisch wurde täglich von seiner Frau Vangelio ausgenommen, gebraten und gegrillt. Heute wird weniger Fisch verzehrt und andere Sorten bestellt. Es habe mit der Krise zu tun, erzählt Perikles: „Vor der Finanzkrise verlangten die Gäste Doraden, Wolfsbarsche, Rote Meerbarben und andere edle Fische. Doch die sind teuer. Heute greifen viele Griechen auf die preiswerteren Sardinen zurück oder bestellen frittierte Sardellen.“ Fisch und Meeresfrüchte sind in Griechenland vergleichsweise teuer. Selbst hier am Meer. Und Perikles achtet penibel darauf, dass seine Fische immer frisch sind. Er hat sein Angebot aber geschickt an die krisenbedingte Nachfragesituation angepasst. In seinem zimmerhohen Gastronomiekühlschrank, wo früher fast ausschließlich große Fische darauf warteten, abends gegrillt zu werden, ist es heute abwechslungsreicher. Jetzt findet man auch regelmäßig „Γόπες (Gopes) und Γαύρος (Gavros) – Gelbstriemen und Anchovis“. Alles stets fangfrisch.
Tolo war früher ein reines Fischerdorf, mit nur wenigen Einwohnern, von denen die meisten ihren Lebensunterhalt vom Fischfang bestritten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten nur wenige hundert Einwohner hier. Heute sind es knapp zweitausend. Der große Touristenboom zum Ende des 20. Jahrhunderts ist zwar vorbei, dennoch ist der Ort in den Sommermonaten noch immer ordentlich besucht. Die immer noch zahlreichen Fischer wird es freuen. Auch den Touristen haben sie es zu verdanken, dass sie von ihrer Arbeit leben können. Jeden Nachmittag ab 18 Uhr sitzen die Fischer unten am Hafen, an der alten Kantina. Schon von Weitem sehe ich die alten Männer auf ihren klebrigen Plastikstühlen und klapprigen Holzbänken. Ich geselle mich zu ihnen und befrage sie zum Fischfang in Tolo.
„Heute leben über einhundert Fischer hier. Früher waren wir viel weniger“, sagt Grigoris und streicht sich nachdenklich über seinen Schnurrbart. Seine Lippen sind zu einem Dauerlächeln gebogen. Grigoris schaut auf den Hafen und auf „sein Meer“. Er sieht aus wie die personifizierte Zufriedenheit. Vangelis wendet sich mir zu: „Aber der Fischfang ist kein Kinderspiel. Es ist harte Arbeit. Jetzt im Sommer ist es warm, aber im Winter kann es bitterkalt werden. Ein echter Knochenjob, dann.“ Er blickt nachdenklich auf seine schwieligen, von den Netzen geschundenen und von den stacheligen Fischen aufgepieksten Hände. Er ist der jüngste in der kleinen Runde und liebt sein Leben als Fischer in Tolo, genauso wie seine erfahreneren Kollegen. Der alte Mimis mit der dicken Hornbrille auf der knubbeligen Nase und dem Gehstock zwischen den immer noch muskulösen Beinen blickt gedankenverloren auf das Meer, während er gleichzeitig an mich gerichtet erzählt: „Früher gab es noch keine Dieselmotoren. Als mir mein Vater das Fischen beibrachte, hatten wir große Leinentücher als Segel. Die traditionellen Kaikis hatten noch einen Mast. Wir sind gesegelt!“
Mit stolzer Brust erzählen mir die Fischer von der alten Zeit. Und fast zeitgleich sprudelt es aus ihnen heraus: „Damals gab es noch Fisch in rauen Mengen. Alle heimischen Fischarten. Stattliche Exemplare. Paradiesische Zeiten für uns Fischer damals.“
An diesem Abend esse ich Fisch bei Perikles und studiere Statistiken über den Fischfang in Griechenland. Im Jahr 2009 waren in Griechenland offiziell 12.200 Fischer gemeldet. Einer von ihnen ist Dimitri, der von seinen Freunden liebevoll Mitso genannt wird. Er tauscht gerade in der Taverne eine leere Bierflasche gegen eine volle. Dann wünscht er mir eine gute Nacht. Ich solle nicht zu spät schlafen gehen, denn er hole mich morgen früh sehr zeitig ab. Wir wollen gemeinsam seine Netze einholen.
Kurz nach Sonnenaufgang, erscheint der 60-jährige Dimitri bei Perikles. Er trägt sein schmuddeliges T-Shirt, unter dem sich trotz seiner Vorliebe für viele Flaschen Bier pro Tag nicht einmal der Ansatz eines Bierbäuchleins abzeichnet. Auch sein zotteliges, schulterlanges Haar und sein Drei-Wochen-Bart sind beeindruckend. Mit seinen schwieligen Barfüßen und dem unvollständigen Gebiss wirkt er wie die perfekte Inszenierung eines Fischer-Urgesteins. Als wir an seinem Kaiki ankommen, winkt mich Mitso mit seiner Bierflasche zu sich heran: „Komm an Bord! Wir fahren gleich los. Setz dich da vorne hin und mach es dir bequem!“ Dann sucht Mitso bereits unter Deck nach seinem Fischeroutfit und legt es bereit. Gelbes Ölzeug. Latzhose und Jacke. Die Fahrt kann beginnen. Der Dieselmotor schiebt uns langsam auf das spiegelglatte Meer hinaus. Rund 6.500 Fischerboote sind in Griechenland offiziell gemeldet. Sie kommen rechnerisch auf eine Durchschnittsbesatzung von zwei Mann. So gesehen befinde ich mich auf einem Durchschnittskaiki. Doch so gar nicht durchschnittlich ist Kapitän Mitso. Während wir an der Insel Romvi vorüber fahren, stellt er seine halbvolle Amstelflasche am Ruderstand ab. Er rät mir vorsichtig zu sein, wenn ich in die Nähe der Gewindestange für die Netzeinholvorrichtung gerate. Dann fischt er bereits mit geschickter Hand nach seinem Ölzeug. In Windeseile ist er damit „eingekleidet“, wenn man angesichts der Fetzen überhaupt von Kleidung sprechen möchte. Mindestens so alt wie das Kaiki vermute ich das Ölzeug, aber in schlechterem Zustand.
Eine Weile später schaltet Mitso den Motor in den Leerlauf. „Wir sind da! Wir holen jetzt die Netze ein. Vorsicht an der Kette!“, ruft er mir zu, dann beginnt sich die Winde zum Einholen des Netzes zu drehen. Über zwei etwa felgengroße Metallrollen legt der Kapitän einhändig das Ende des Seils, an dem das Netz befestigt ist. Die andere Hand braucht er für seine Bierflasche. Die ölverschmierte Kette quietscht und knarzt, während der Einholvorgang beginnt. „Das Netz ist siebenhundert Meter lang“, sagt Mitso. Es hat an der unteren Kante Bleigewichte, die es am Grund halten und an der oberen Kante sind Auftriebskörper befestigt. Genau die gleichen, wie sie Mitsos Hund am Halsband trägt. Der Kapitän hält einen Teil des Netzes in die Höhe: „So wird es vom Meeresgrund bis zwei Meter darüber gehalten.“ Er erklärt mir ausführlich das Prinzip der Netzfischerei. Es dauert, bis der Anfang des Netzes über die Bordwand gleitet. Jetzt ist Mitsos Geschick gefragt. Mit geübten Griffen legt er das Netz langsam zu einem geordneten Haufen, während er gleichzeitig größere Beifänge, wie Steine, Algenbüschel oder Muscheln aus den Maschen entfernt. Auch eine gut dreißig Zentimeter große Muschel plumpst laut auf die Schiffsplanken. Das erste auffallend Bewegliche ist jedoch ein kleiner Oktopus. Obwohl seine acht Beine mit den Saugnäpfen in dem Netz stecken, fischt Mitso ihn in spielerischer Leichtigkeit einhändig aus den Maschen. Es folgen einige kleine Fische.
Das Netz wird immer weiter aus der Tiefe gezogen. Die Ausbeute an diesem Morgen ist recht ordentlich. Tief dunkelblau schillert das Meer in der morgendlichen Sonne, während sich das verblichen-gelbe Netz mit den etwa fünf Zentimeter feinen Maschen an Deck immer weiter, scheinbar ungeordnet, zu einem Haufen zusammenlegt. Einige Sargos – Bindenbrassen – sind bereits eingewickelt, da plumpst ein größerer Brocken auf den Schiffsboden. Feurig rot zappelt ein etwa unterarmlanger Skorpios in den Maschen. Der Skorpionsfisch wirkt bizarr. Ein knorriger Dickschädel mit vielen spitzen Dornen, großen Augen und ledrig-fester Haut. „Das ist ein besonders guter Fisch für eine leckere Suppe“, sagt Mitso und wickelt den Skorpios aus dem Netz. Kurz darauf blicke ich etwas erschrocken auf das, was gerade über die Bordwand gezogen wird. In schillernden Regenbogenfarben zappeln merkwürdige Gestalten neben meinen Füßen, die mich zuerst an bunte Fledermäuse erinnern. „Mitso, was zum Teufel ist das?“, frage ich meinen Kapitän. „Oh, das sind Chelidonopsara – fliegende Fische!“ Gelassen trinkt Mitso einen weiteren Schluck aus seiner Amstelflasche und hält mir den einen dieser Flattermänner an den Flügeln ausgebreitet vors Gesicht. Spannweite etwa siebzig Zentimeter würde ich schätzen. Mitso, der Mann für die speziellen Meeresbewohner, grient. In der Sonne glänzen die blauen Flügel perlmuttartig edel. Sie reichen von den Kiemen bis fast zum Schwanz und breiten sich elegant wie die Schwerter eines holländischen Plattbodenbootes zu den Enden hin bauchartig aus. Auf diesen flügelähnlichen Bauchflossen können die grazilen Fische bis zu zehn Sekunden lang über dem Meer gleiten, wenn sie, auf der Flucht vor ihren Feinden, aus dem Wasser springen. Die Tiere gelten als Delikatesse. „So, jetzt haben wir es gleich geschafft“, sagt Mitso. „Kein schlechter Fang heute. Das Netz ist gleich komplett an Bord.“ Er nimmt noch einen Schluck aus seiner Flasche Amstel, bevor es bald zurück an Land geht.
Als ich eine Weile später meinen Morgenkaffee auf Perikles’ Terrasse trinke, kommt Mitso vorbei. In der rechten Hand sein Amstel, in der linken eine Plastiktüte. Der Fischhändler hat ihm nicht den gesamten Fang des Tages abgekauft. Die fliegenden Fische wollte er nicht. Spontan frage ich Mitso, ob ich ihm davon welche abkaufen kann. „Nein!“ Er besteht darauf, sie mir zu schenken. Nun geht es hin und her; am Ende setze ich mich durch. Ich stecke ihm aufdrängend wenigstens einen 10€-Schein zu. „Na gut“, willigt er schließlich ein. „Das reicht für mein Bier heute.“ Wir lachen gemeinsam aus vollem Herzen, und ich schleppe die Tüte mit den Fischen zu unserem Tisch. Als meine Familie die fledermausähnlichen Kreaturen erblickt, sind sich alle außer mir spontan einig: „Das essen wir nicht!“
Am späten Abend schafft Perikles’ Schwester Irini dann jedoch das schier Unmögliche. Als sie uns eine „fliegende Fischsuppe“ serviert, deren Duft allen genug Mut einflößt, die Fische doch zumindest mal zu probieren, ist der Bann gebrochen. Nach einem zögernden Nippen am Suppenlöffel wird es hektisch am Tisch. Innerhalb kürzester Zeit wird alles aufgegessen und ich blicke in strahlende Gesichter. „So eine herrliche Suppe habe ich noch nie gegessen“, sagt Opa Manfred zum Schluss und streicht sich wohlig über den Bauch. Eine Suppe aus dem Skorpionsfisch hätte sicher nicht besser sein können. Perikles bringt noch ein Bier. „Damit kann kein deutsches Bier mithalten“, ruft Opa Manfred glücklich in die Runde und prostet uns zu. Mit seinem Mythos. Mitso schlummert derweil bereits in seinem Bett und träumt vom Fischen. Oder?